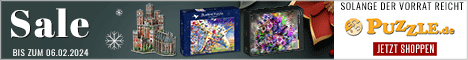Wenn Sie sich dazu entschlossen haben, kein vorgefertigtes Balkonkraftwerk-Set zu erwerben – aus welchem Grund auch immer, sei es aus finanziellen Überlegungen oder persönlicher Präferenz – stehen Sie vor einer wichtigen Frage: Wie finden Sie die passenden Komponenten, die reibungslos miteinander arbeiten? In diesem Artikel möchte ich Ihnen dabei helfen, diese Herausforderung eigenständig zu bewältigen. Ein wenig Rechnen ist erforderlich, aber keine Sorge, die vier Grundrechenarten genügen vollkommen.
Bereits im vorherigen Teil dieser Artikelserie haben wir in der Planungsphase die Vorarbeit geleistet. Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie bereits festgelegt haben, welchen Leistungsbedarf Ihr eigener Wechselrichter haben soll, wie viele Solarmodule Sie aufstellen möchten und mit welcher Leistung, sowie in welche Richtungen sie ausgerichtet werden sollen.
Ich möchte an dieser Stelle erneut betonen, dass Arbeiten am 230V-Stromnetz potenziell lebensgefährlich sein können. Wenn Sie keine elektrotechnische Ausbildung haben, ist es dringend ratsam, derartige Tätigkeiten einem qualifizierten Elektriker zu überlassen. Ihre Sicherheit sollte immer oberste Priorität haben.
Die richtigen Module und der richtige Wechselrichter
Die richtigen Solarmodule für Ihren Wechselrichter finden oder den richtigen Wechselrichter für Ihre Module – das ist die Frage, die viele angehende Balkonkraftwerk-Enthusiasten beschäftigt. Aber wie sollten Sie am besten vorgehen? Sollten Sie zuerst einen passenden Wechselrichter auswählen und dann darauf abgestimmte Solarmodule suchen, oder ist es besser, den umgekehrten Weg einzuschlagen? Hier ist meine Empfehlung: Beginnen Sie immer dort, wo die Anforderungen am kritischsten sind.
Wenn Sie beispielsweise nur begrenzten Platz auf Ihrem Balkongeländer für Solarmodule haben und die Abmessungen eine Rolle spielen, ist es sinnvoll, mit der Auswahl der passenden Module zu starten. Anschließend können Sie nach einem Wechselrichter suchen, der zu diesen Modulen passt. Im umgekehrten Fall, wenn Sie einen bestimmten Wechselrichter mit besonderen Eigenschaften wünschen (wie eingebautes WLAN), können Sie diesen zuerst auswählen und dann die dazu passenden Module finden.
Falls Sie nicht allzu vertraut mit den elektrotechnischen Grundbegriffen wie Spannung, Strom, Parallel- und Reihenschaltung sind, empfehle ich Ihnen, sich bei Bedarf den Teil 5 dieser Artikelserie anzusehen, wo diese Begriffe ausführlich erklärt werden.
Warum können nicht alle Solarmodule mit allen Wechselrichtern kombiniert werden? Das liegt daran, dass Solarmodule eine unterschiedliche Anzahl von Solarzellen und unterschiedliche elektrische Eigenschaften haben. Gleichzeitig verfügen Wechselrichter über unterschiedliche elektrische Eigenschaften und eine variable Anzahl von Solareingängen. Daher ist es nicht möglich, wahllos Module und Wechselrichter zu kombinieren und zu erwarten, dass sie reibungslos funktionieren. Das erklärt auch, warum einige Anbieter Sets anbieten, in denen Module und Wechselrichter bereits aufeinander abgestimmt sind. Aber keine Sorge, wir können lernen, Datenblätter zu lesen und passende Konfigurationen selbst zu erstellen. Es ist gar nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag.
Es gibt zwei grundlegende Anforderungen, wenn es darum geht, Solarmodule mit einem Wechselrichter zu verbinden:
- Die Solarmodule dürfen den Wechselrichter nicht beschädigen.
- Der Wechselrichter sollte die Leistung der Module optimal umsetzen können.
Lassen Sie uns diese Anforderungen im Folgenden genauer betrachten.
Anforderung 1: Solarmodule sollten den Wechselrichter nicht überlasten
Überlasten klingt vielleicht dramatisch, aber in der Realität sind die meisten Wechselrichter intelligenter, als man denkt. Im Falle einer drohenden Überlastung schalten sie sich einfach ab, um Schäden zu vermeiden. Doch das ist sicherlich nicht das, was Sie im Sinn haben, und wir auch nicht.
Ein häufiges Missverständnis unter Laien ist, dass, wenn die Leistung der Solarmodule größer ist als die des Wechselrichters, dies zu einer Überlastung führen könnte. Ebenso wird oft vermutet, dass ein höherer angegebener maximaler Betriebsstrom der Solarmodule den Wechselrichter in die Knie zwingen würde. Das sind jedoch falsche Annahmen – so funktioniert die Stromversorgung nicht.
Um das besser zu verstehen, betrachten Sie Leistung und Stromstärke als die Bereitschaft der Solarmodule, Energie zu liefern, wenn ein Verbraucher sie benötigt. Im Leerlauf, also wenn keine Verbraucher angeschlossen sind, fließt weder Strom noch wird Leistung erzeugt. Das Einzige, was in diesem Zustand vorhanden ist, ist die Spannung. Diese Spannung ist der entscheidende Parameter bei der Verbindung zwischen den Solarmodulen und dem Wechselrichter, ähnlich wie bei jedem anderen Stromerzeuger und Verbraucher.
Da die Spannung von entscheidender Bedeutung ist, ist es wichtig zu prüfen, ob die Eingangsspannung des Wechselrichters im sicheren Bereich liegt. Angenommen, der Wechselrichter verträgt eine maximale Eingangsspannung von 60V, und die Leerlaufspannung des Solarmoduls beträgt 50,1V. Dies zeigt, dass die Ausgangsdaten vielversprechend sind.
Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass die Spannungsangabe des Solarmoduls mit einer Fußnote versehen ist. Diese besagt, dass die Spannung nur unter bestimmten Bedingungen gültig ist, nämlich bei einer Umgebungstemperatur von 25 Grad Celsius und einer Solarstrahlungsleistung von 1000W/m². Um dies genauer zu verstehen, werfen wir einen Blick auf das Datenblatt, auf dem ein Temperaturkoeffizient von -0,25% pro Kelvin für die Leerlaufspannung angegeben ist. Das bedeutet, dass sich die Leerlaufspannung um -0,125V pro Grad Celsius ändert, was zur Folge hat, dass sie bei sinkenden Temperaturen ansteigt.
Angenommen, es herrscht an einem besonders kalten Wintertag eine Temperatur von -15 Grad Celsius. Dies führt zu einer Temperaturdifferenz von -40 Grad im Vergleich zu den 25 Grad, bei denen die Spannung gemessen wurde. Diese Differenz entspricht einer Spannungserhöhung von 40 x 0,125V, also 5V. Selbst bei -15 Grad Celsius läge die Leerlaufspannung immer noch unterhalb der Wechselrichter-Grenze von 60V.
In Deutschland ist es selten, dass die Solarstrahlungsleistung über 1000W/m² erreicht. Selbst wenn dies der Fall ist, hat dies in der Regel keinen Einfluss auf eine Erhöhung der Modulspannung. Im Gegenteil, bei intensiver Sonneneinstrahlung steigen oft die Temperaturen der Solarmodule, was zu einer Reduzierung der Spannung an sonnigen Tagen führen kann. Daher ist es nicht notwendig, die Solarstrahlung in Bezug auf die maximale Leerlaufspannung zu berücksichtigen.
Merkregel: Die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters darf nicht überschritten werden. Auf der Seite der Solarmodule ist dabei die Leerlaufspannung von Bedeutung, die bei sinkenden Temperaturen ansteigt. Daher sollte immer ein ausreichender Puffer eingeplant werden.
Anforderung 2: Optimale Leistungsumsetzung durch den Wechselrichter
Im vorherigen Abschnitt haben wir bereits erläutert, wie entscheidend es ist, den Wechselrichter vor Schäden durch falsche Modulbelegung zu schützen. Doch es ist ebenso wichtig sicherzustellen, dass der Wechselrichter die zur Verfügung gestellte Leistung der Solarmodule effizient nutzen kann. Dies geschieht durch die sogenannte “Maximum Power Point Tracking” (MPPT) Technik, bei der der Wechselrichter den eigenen Innenwiderstand anpasst, um den optimalen Arbeitspunkt für Stromfluss und Spannung zu finden.
Diese Anpassung erfolgt kontinuierlich, da sich der optimale Arbeitspunkt aufgrund von Veränderungen in der Sonneneinstrahlung und anderen Faktoren ständig verschiebt. Jeder Wechselrichter hat daher einen angegebenen MPPT-Spannungsbereich auf dem Typenschild und im Datenblatt. Dieser Bereich bestimmt, in welchem Spannungsbereich der MPP-Tracker versucht, die optimale Leistungsausbeute zu erzielen. Im obigen Beispiel liegt dieser Bereich zwischen 34 und 48V. Wie Sie sehen, ist dies ein Teil des allgemeinen Arbeitsbereichs des Wechselrichters, der zwischen 16 und 60V liegt. Um die MPPT-Technik effektiv nutzen zu können, sollte die maximale Betriebsspannung des Solarmoduls in diesem MPPT-Bereich liegen. Bei einem Wert von 42,0V im Beispielmodul ist diese Anforderung erfüllt, was bedeutet, dass das Solarmodul eine Spannung liefert, die gut mit dem MPP-Tracker im Wechselrichter zusammenarbeitet.
Nun schauen wir auf den Strom. Der Wechselrichter hat einen maximalen dauerhaften Eingangsstrom von 12,5A definiert, während das Solarmodul im Betrieb maximal 10,01A liefert und selbst im Kurzschlussfall nur 10,58A. In diesem Beispiel passt alles gut zusammen.
Aber was passiert, wenn der Betriebsstromwert des Moduls höher ist als der maximale Eingangsstrom des Wechselrichters? In solchen Fällen sorgen sich einige Menschen und fürchten, der Wechselrichter könnte durch den hohen Strom überlastet werden. Das ist jedoch nicht der Fall. Der auf dem Solarmodul angegebene Strom ist der maximale Strom, den das Modul liefern kann. Aber er wird nicht zwangsläufig und mit Gewalt geliefert. Der tatsächlich fließende Strom wird hauptsächlich durch den Widerstand des Verbrauchers bestimmt, also den inneren Widerstand des Wechselrichters, den der MPP-Tracker selbst reguliert. Der Wechselrichter wird niemals seine eigenen Grenzen überschreiten.
Daher gilt, solange die Betriebsspannung des Solarmoduls innerhalb der Grenzen des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegt, wird der maximal angegebene Modulstrom nur dann höher sein als der maximale Eingangsstrom des Wechselrichters, wenn das Solarmodul tatsächlich mehr Leistung erzeugen kann, als der Wechselrichter benötigt. Dies tritt häufig bei solarem Overpowering auf, wenn mehr Watt-peak (mehr oder größere Module) installiert sind, als die Wechselrichterleistung erfordert. In solchen Fällen regelt der Wechselrichter den überschüssigen Solarstrom herunter, um sicherzustellen, dass nicht mehr Leistung in das 230V-Netz eingespeist wird, als auf dem Typenschild angegeben ist.
Merkregel: Die maximale Betriebsspannung des Solarmoduls sollte sich im MPPT-Bereich des Wechselrichters befinden, um eine maximale Leistungsausbeute sicherzustellen. Die Stromwerte sind dabei von nachrangiger Bedeutung.
Fazit
Die Auswahl der richtigen Komponenten für Ihr eigenes Solaranlagenprojekt ist von entscheidender Bedeutung, da sie den Erfolg und die Effizienz Ihrer Anlage maßgeblich beeinflusst. In erster Linie geht es darum sicherzustellen, dass die Solarmodule und der Wechselrichter optimal miteinander interagieren, um eine reibungslose und effektive Energieerzeugung zu gewährleisten. Hierbei steht jedoch die Sicherheit immer an erster Stelle.
Ein entscheidender Faktor bei der Auswahl der Komponenten ist die Leerlaufspannung der Solarmodule, die sicher innerhalb des vom Wechselrichter tolerierten Bereichs liegen sollte. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da eine zu hohe Leerlaufspannung den Wechselrichter beschädigen oder sogar gefährliche Situationen herbeiführen kann. Daher ist es unerlässlich, dass die Spannungseigenschaften der Solarmodule mit den Spezifikationen des Wechselrichters kompatibel sind.
Ebenso wichtig ist die Positionierung der Betriebsspannung des Solarmoduls im sogenannten MPPT-Bereich des Wechselrichters. Dieser Bereich bestimmt, in welchem Spannungsbereich der Wechselrichter seine maximale Leistungsfähigkeit erreicht und somit die optimale Energieerzeugung gewährleistet. Die korrekte Abstimmung der Betriebsspannung des Moduls mit diesem Bereich ist entscheidend, um die maximale Leistung Ihrer Solaranlage zu erzielen.
Insgesamt ist die sorgfältige Auswahl der Komponenten und die Gewährleistung ihrer Kompatibilität von großer Bedeutung, um ein erfolgreiches und effizientes Solaranlagenprojekt zu realisieren. Dabei ist die Sicherheit und die Maximierung der Leistung von höchster Priorität.
Im nächsten Teil dieser Artikelserie werden wir uns eingehender mit der Kombination und Verschaltung von Solarmodulen und Wechselrichtern befassen. Dabei werden wir verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten und Anschlussdiagramme besprechen, um Ihnen bei Ihrem DIY-Solarprojekt bestmöglich zu helfen. Bleiben Sie also dran, um mehr über dieses spannende Thema zu erfahren.